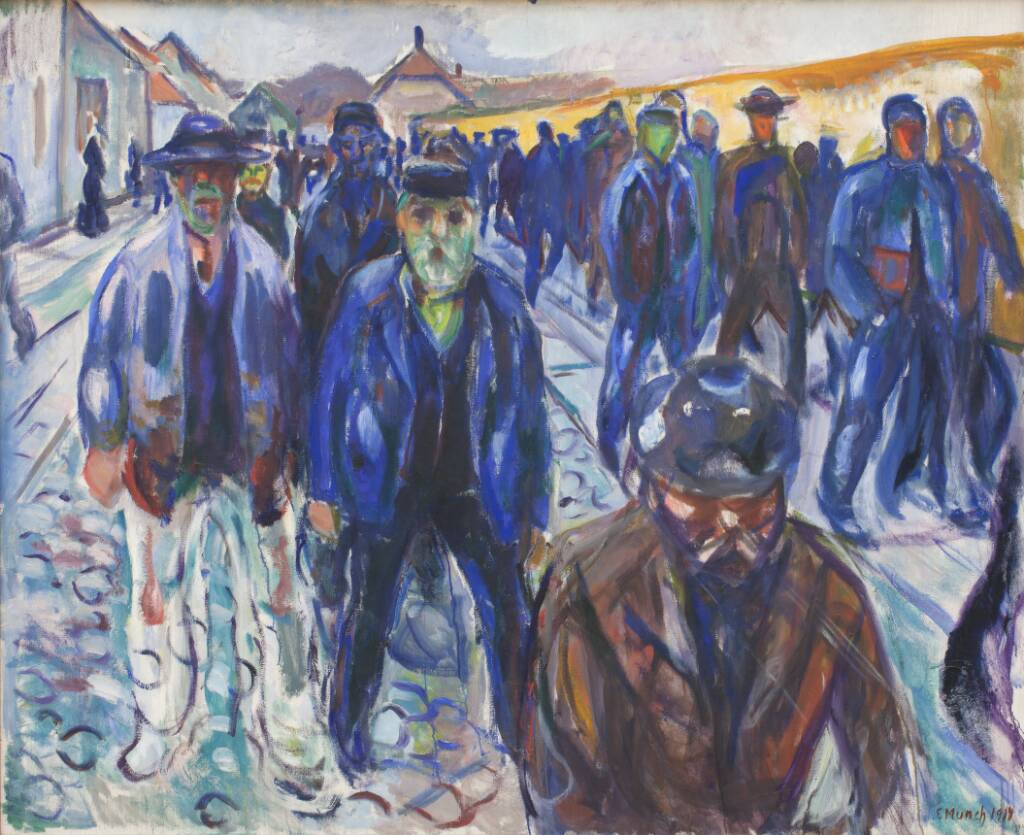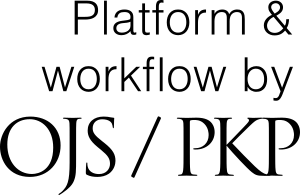Handeln, indem man behauptet, dass Gott handelt
Pragmatik der religiösen Rede vom Handeln Gottes
DOI:
https://doi.org/10.71956/cdth001-art06Abstract
Die Rede vom Handeln Gottes hat im Christentum und im Islam starke Referenzen in den jeweiligen Traditionen. Christ:innen und Muslime dürfen daher erwarten, dass man von den eigenen ›Glaubensschwestern und -brüdern‹ verstanden wird, wenn sie behaupten, dass Gott handelt. Doch was tun sie, wenn sie ein Ereignis als Handeln Gottes behaupten und damit von anderen verstanden werden wollen? Diese Frage sucht der Beitrag durch pragmatistische Rekonstruktion der religiösen Rede vom Handeln Gottes aufzuklären. Dazu wird ›Gott handelt …‹ als eine Basishandlung und – darauf aufbauend – als Moment komplexer Glaubenspraxis untersucht: In der Interaktion mit ›Glaubensschwestern und brüdern‹ können Akteure mit ›Gott handelt …‹ Bezug auf Ereignisse nehmen, die ihnen andernorts und damit in einer ursprünglichen Situation ›passieren‹. Mit ihrer Behauptung erschaffen sie innerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft eine Handlungssituation oder handeln mit ihrer Behauptung in einer innerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft vorgefundenen Situation. Sie können die sich ihnen dort stellenden Herausforderungen bewältigen und dadurch ihr Gottesverhältnis bewähren, – können also glauben. Allerdings ›ersetzt‹ dieser Glauben nicht den Glauben, den sie in der ursprünglichen Situation vollziehen, indem sie dort – in Antwort auf das sich dort ereignende Handeln Gottes – handeln und dazu etwas anderes tun, als ›Gott handelt …‹ zu behaupten. In der Interaktion mit ihren ›Glaubensschwestern und -brüdern‹ verändert die Behauptung die dort jeweils geltende Sinnwelt und dadurch auch die jeweilige Handlungssituation: Gott selbst hat in der Welt eine Handlungssituation und ist darin mit einer auf diese Situation bezogenen Absicht vertreten. Dass diese Anwesenheit festgestellt wird, ist in der Interaktion der ›Glaubensschwestern und -brüder‹ affirmativ, konnektiv und imperativisch wirksam.